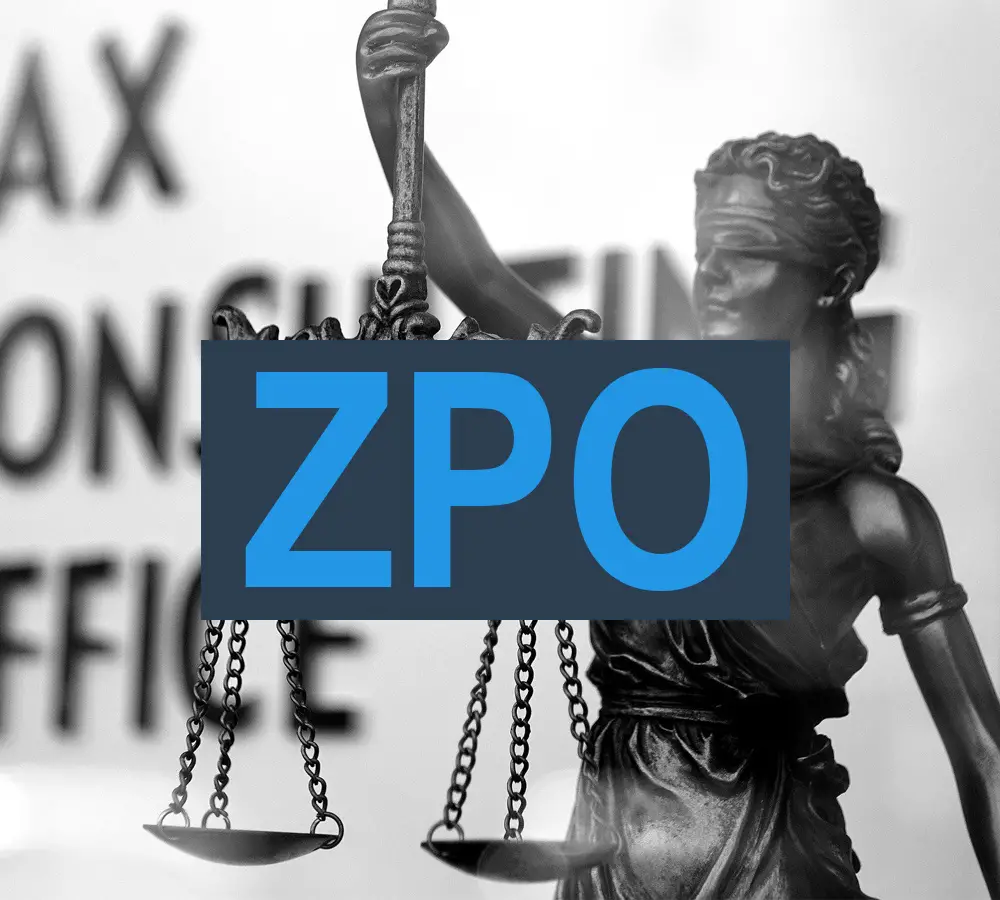Schutz des Körpers und der Gesundheit nach § 823 Abs. 1 BGB
Grundtatbestand des § 823 Abs. 1 BGB
- Rechts- oder Rechtsgutverletzung
- Leben
- Körper und Gesundheit
- Freiheit
- Eigentum
- Sonstige Absolute Rechte
- Besitz
- Allgemeines Persönlichkeitsrecht (APR)
- Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (ReaG)
- Verletzungshandlung
- Haftungsbegründende Kausalität
- Rechtswidrigkeit
- Verschulden
- Schaden
- Haftungsausfüllende Kausalität
- Mitverschulden, § 254 BGB (vgl. § 846 BGB)
Auch die Zerstörung oder Beschädigung eines abgetrennten Körperteils, welches nur temporär entfernt wurde aber mit der Bestimmung des Berechtigten, dass es später wieder mit dem Körper zusammengefügt werden soll, stellt eine Körperverletzung dar.[2] Dies folgt aus dem Recht des Körpers als Ausdrucksform des allgemeinen Persönlichkeitsrecht,[3] weshalb es diesem Rechtsgedanken nicht entsprechen würde, wenn man mit einer Beschädigung oder Zerstörung (lediglich) eine Sachbeschädigung annehmen würde.
Sonderprobleme:
-
Ärztlicher Behandlungseingriff
Ein ärztlicher Behandlungseingriff ist tatbestandsmäßig eine Körperverletzung und steht mit den Vorschriften des Behandlungsvertrages in echter Anspruchskonkurrenz.[6] Eine Einwilligung oder eine berechtigte GoA rechtfertigt diesen Eingriff.[7] Voraussetzungen für eine Einwilligung stehen in § 630d BGB, insbesondere muss sie vor dem Eingriff eingeholt werden.[8] In § 630h BGB stehen Vorschriften zur Beweislast(-umkehr).[9]
-
Verletzung eines Kindes im Mutterleib
In dieser besonderen Fallkonstellation können drei weitere Fälle bestehen:
-
Schädigung des Kindes im Mutterleib (nasciturus)[10]
(P) Problematisch ist, dass nach § 1 BGB keine Rechtsfähigkeit vorliegt, da das Kind noch nicht geboren wurde.
823 Abs. 1 BGB: (+), sofern das Kind ohne die schädigende Handlung gesund geboren wäre.[11]
-
Krankes Leben (wrongful life)[12]
Ein Unterschied zum vorherigen Nasciturus-Fall liegt darin, dass hier nicht die Wahl zwischen krank und gesund sein besteht, sondern entweder Schwangerschaftsabbruch oder eben dem kranken Leben.[13]
823 Abs. 1 BGB: (-), denn eine Pflicht, einen Schwangerschaftsabbruch hervorzurufen aufgrund der Krankheit des Kindes im Mutterleib, existiert so gesehen nicht.[14]
-
Kind als (wirtschaftlicher) Schaden
Fraglich ist, ob die Eltern bzw. die Ehefrau Schadensersatz für den Unterhalt des Kindes geltend machen können.
Der BGH spricht den Ehegatten einen Anspruch auf Ersatz der Unterhaltskosten zu.[16] Zudem ist die gegen den Willen der Ehefrau herbeigeführte Schwangerschaft eine Körperverletzung und begründet einen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB für die Ehefrau.[17]
Zurück zur Übersicht „Deliktsrecht“[1] Wandt, Gesetzliche Schuldverhältnisse – Deliktsrecht, Schadensrecht, Bereicherungsrecht, GoA, 9. Auflage, 2018, § 16, Rn. 4.
[2] Supra.
[3] Supra (Fn. 1).
[4] Supra (Fn. 1).
[5] Supra (Fn. 1).
[6] Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 7.
[7] Supra.
[8] Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 9.
[9] Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 8.
[10] BGHZ 8, 243; 58, 48; 93, 351; Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.
[11] Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.
[12] BGHZ 86, 240; vgl. NJW 2006, 1660; Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.
[13] Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.
[14] Supra.
[15] BGHZ 76, 249; 124, 128; BGH NJW 1995, 2407; Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.
[16] BGH NJW 1995, 2407, 2409; Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.
[17] BGH NJW 1995, 2407, 2408; Wandt, (Fn. 1), § 16, Rn. 11.